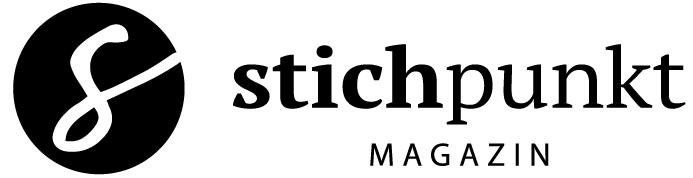Prof. Franz Ruppert im Interview
Sind Fragen der Identität wichtiger geworden? Stimmt die Wahrnehmung, dass sich Menschen in den letzten drei Jahren vor allem in gesellschaftspolitischen Fragen mehr und mehr als Freund oder Feind gegenüberstehen? Drücken Worte wie „Identitätspolitik“ aus, dass sich Menschen leicht aus einem bestimmten Verständnis von Identität heraus zu starken Aus- und Abgrenzungen gegenüber denjenigen hinreißen lassen, die diesem Verständnis entgegenstehen? Wie entwickelt sich Identität gesund? Fragen, auf die der Münchener Professor für Psychologie an der Katholischen Stiftungshochschule München eine Antwort weiß.
Christiane Borowy: Lieber Prof. Dr. Franz Ruppert, Sie sind der Begründer der identitätsorientierten Psychotraumatherapie(IoPT). Deshalb ist meine erste Frage an Sie zunächst eher grundsätzlicher Natur. Was ist überhauptIdentität?
Prof. Franz Ruppert: Ich definiere Identität als die Summe aller Lebenserfahrungen, die ein Mensch schon gemacht hat. Alles, was er schon erlebt hat und sich in seiner Psyche und in seinem Körper niederschlägt, macht diesen einzigartigen Menschen aus.
Sie sagen, Psychotrauma ist eine Realität, die unsere Psyche nicht ertragen kann, weil sie zu schmerzhaft oder zu emotional ist. Es entsteht eine seelische Wunde, ein Trauma. Jetzt heißt es aber nicht nur Psychotraumatherapie, sondern identitätsorientierte Psychotraumatherapie. Warum liegt der besondere Fokus auf Identität?
Weil hier der Fokus auf dem Einzelnen liegt, nicht auf dem „System“. Nur über die eigene Identität ist eine Auflösung psychischer Spaltungen, als Folge von Traumatisierungen, möglich. Das habe ich in 30 Jahren praktischer Arbeit herausgefunden. Identifikationen sind eine Trauma-Überlebensstrategie, welche sichtbar gemacht und hinter sich gelassen werden müssen, um in die Traumaheilung zu kommen.
In Ihrer Arbeit unterscheiden Sie Identität von Identifikation. Worin liegt der genaue Unterschied?
Bei Identität liegt der Bezugspunkt ganz bei diesem Menschen. Für eine Identifikation habe ich den persönlichen Referenzpunkt im Außen, also zum Beispiel bei einem anderen Menschen, einer Religion, einem Land, und so weiter.
Vielleicht lässt sich das an einem Beispiel illustrieren. Nehmen wir an, man identifiziert sich damit, in einer Demokratie zu leben. Vielleicht spricht man sogar den Satz aus: „Ich bin ein Demokrat“. Dann erlebt man möglicherweise, dass man diffamiert oder eingeschüchtert wird, weil man öffentlich eine abweichende Meinung vertritt. Man bekommt Existenzängste, weil man vielleicht seinen Job verliert oder anderweitig gesellschaftlich ausgegrenzt wird. Zu Demokratie gehört eigentlich das Versprechen, angstfrei leben zu können. Würden Sie sagen, dass man dann ein Psychotrauma erlebt hat?
„Demokratin“ zu sein, ist eine geistige Haltung, die sich aus Ihrem Leben ergeben hat. Das sind Sie dann. Sie müssen sich nicht mit dieser Haltung identifizieren. Wenn Sie allerdings sich politisch engagieren, um von sich selbst abzulenken und dem, was Sie vor allem in Ihrer frühen Kinderzeit erlebt haben, dann könnten Sie das möglicherweise auch als Trauma-Überlebensstrategie ausleben.
Nehmen wir ein weiteres Beispiel. Wie kann es passieren, dass eine gesellschaftliche Gruppe beispielsweise eine „Identität der Geimpften“ ausbildet und in deren Folge ungeimpfte Menschen als Gruppe stigmatisiert, öffentlich beschimpft und aus dem sozialen Leben ausgrenzt?
Das hat mit einem Corona-Narrativ zu tun, das den Menschen einredet, sich eine gentechnische Injektion geben zu lassen, sei ein Beitrag zum Gemeinwohl, was es ja offensichtlich nicht ist. Daher wurden Feindbilder geschaffen, um einen sozialen Druck, sich „impfen“ zu lassen, aufzubauen.
Welche Umstände führen dazu, dass sich die Identität eines Menschen nur schwach ausbildet?
Nach meinen Erfahrungen sind das frühe Traumaerfahrungen: Ein Mensch ist als Kind nicht gewollt, wird von seinen Eltern nicht geliebt und auch nicht vor Gewalt in Schutz genommen.
In Ihrem Buch „Ich will leben, lieben und geliebt werden“ bin ich über die Überschrift „Kindheit ist politisch“ gestolpert. Für die meisten Menschen ist es eine sehr private Angelegenheit, nicht von den Eltern geliebt und vor Gewalt in Schutz genommen worden zu sein. So privat, dass sie sich scheuen, sich einem Therapeuten anzuvertrauen. Können Sie an einem Beispiel illustrieren, wie das gemeint ist?
Traumatisierte Kinder können das politische Engagement später in ihrem Leben als Trauma-Überlebensstrategie missbrauchen. Da gibt es viele Beispiele dafür, zum Beispiel hatte Adolf Hitler eine hochtraumatisierte Mutter und wurde durch sie auch auf der Bindungsebene traumatisiert. Ebenso war sein Vater überaus gewalttätig ihm gegenüber.
CB: In den Medien und politischen Diskussionen begegnet einem in der letzten Zeit vermehrt der Begriff Identitätspolitik. Halten Sie das für einen zutreffenden Begriff, oder müsste es nicht eher „Identifikationspolitik“ heißen?
Ja, die Menschen verwechseln Identifikation mit Identität – das ist ein schwerwiegender Fehler.
Inwiefern schwerwiegend?
Weil damit Täter-Opfer-Dynamiken entfacht werden und die Menschen sich gegenseitig verletzen und bekämpfen und damit neue Traumatisierungssituationen schaffen.
Mein Kollege Tom Wellbrock schreibt in dieser Ausgabe zum Thema Identitätspolitik einen ausführlichen Artikel. Eine seiner Thesen lautet “Identität ist für alle da”. Wenn Identität dadurch definiert ist, dass der Bezugspunkt beim einzelnen Menschen liegt, und sich nicht nach außen richtet, inwiefern könnte Identitätsorientierung dann eine unsoziale Sache werden, weil sich nicht mehr auf die Bedürfnisse anderer Menschen bezogen wird?
Wer sich an seiner eigenen Identität orientiert, orientiert sich automatisch an seinen eigenen gesunden Bedürfnissen. Damit schadet er niemanden. Wenn jeder in einer Gemeinschaft oder Gesellschaft gut für sich und seine Bedürfnisse sorgt, geht es auch der Gemeinschaft gut.
Können Sie etwas zu den Auswirkungen von (charakterlichen oder sozialen) Zuschreibungen und Diskriminierungen auf die menschliche Psyche sagen?
Sie halten einen Menschen davon ab, sich auf seine eigenen Bedürfnisse zu fokussieren und sich stattdessen von den Bedürfnissen anderer und von Macht- und Geldinteressen manipulieren zu lassen.
Was wäre Ihre Empfehlung an Menschen, die Opfer von Zuschreibungen und Diskriminierung geworden sind?
Sie sollten daran denken: Wenn ein anderer Mensch mit einem Finger auf mich zeigt, zeigt er zugleich mit drei Fingern auf sich selbst.
Wie können Ihrer Ansicht nach gesellschaftliche Identifikationen und Spaltungen aufgelöst werden, wie führt man eine Gesellschaft in die Ganzheit zurück?
Das geht nur über das Bewusstsein, wie sehr diese Gesellschaft traumatisiert ist und Traumatisierungen systematisch fördert, und dass wir erkennen, wie schädlich es ist, andere Menschen zu traumatisieren für die gesamte Gesellschaft. Niemand hat dadurch auf lange Sicht einen wirklichen Nutzen. Also das Wissen über Trauma und seine vielfältigen Folgen sollte überall, so gut es geht, weiterverbreitet werden. Wir müssen uns also in der Tiefe für die menschliche Psyche interessieren, und wie sie sich von Anfang an entwickelt und wie empfindlich die kindliche Psyche für dauerhafte Schädigungen ist.
Herr Prof. Dr. Franz Ruppert, vielen Dank für das Interview und Ihre Zeit.
1992 wurde Franz Ruppert zum Professor für Psychologie an der Katholischen Stiftungshochschule München berufen. Dort hält er seitdem Vorlesungen und Seminare für Sozial- und KindheitspädagogInnen. 1999 erhielt er vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung die Approbation als psychologischer Psychotherapeut für tiefenpsycholgischfundierte Psychotherapie. Seit 2000 ist die Psychotraumatologie der Hauptinhalt meiner Lehr- und Forschungstätigkeit geworden. Sie geht Hand in Hand mit der Entwicklung einer innovativen Methode der Traumatherapie für das Gruppen- und Einzelsetting. Eine Reihe persönlicher Lebenserfahrungen stellt er in seinen Büchern “Wer bin Ich in einer traumatisierten Gesellschaft?” und “Liebe, Lust & Trauma” dar.
https://franz-ruppert.de
Der Artikel ist in der Print-Ausgabe #5 03/2023 des Stichpunkt Magazins erschienen.
Über den Autor
Christiane Borowy, Jahrgang 1968, ist Soziologin, Sozialpsychologin, Körperpsychotherapeutin und Sängerin. Sie ist Gründerin und Leiterin des seit Ende 2015 bestehenden „borowita — Institut für Sozial-Kulturelle Arbeit“. Mit ihren Seminaren zur persönlichen und politischen Bildung, beispielsweise mit „Hurra, wir streiten uns - wie man gewaltfrei kommuniziert“, setzt sie ihre Vision harmonischer Gemeinschaftsbildung um.