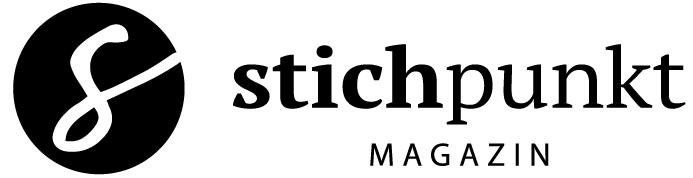Kürzlich war ich für zwei Tage in Wien – es war nass und kalt, aber es gab keine der in den letzten beiden Jahren bereits zu Beginn der kühlen Jahreszeit verordneten Corona-Maßnahmen. Wien hatte bislang eine besonders strenge Covid-Strategie, die über die im Rest von Österreich verordneten Regeln häufig noch weit hinaus ging – die einen fühlen sich sicherer und für andere wird es ungemütlich.
Ich freute mich sehr auf den ersten maßnahmenfreien Städtetrip mit Hotelübernachtung der letzten beiden Jahre, auch wenn ausgedehnte Spaziergänge in den Parkanlagen von Schloss Schönbrunn wohl wetterbedingt nicht auf dem Programm stehen würden. Im Vorfeld hatte ich ein wundervolles, zentral gelegenes Hostel entdeckt: Vielleicht zu jugendlich für mich, aber ich war neugierig, hatte gebucht und fühlte mich auf Anhieb wohl. Trotz schlechtem Wetter wollte ich gleich nach der Ankunft die Umgebung erkunden und Wiener Luft schnuppern. Die Lobby war beinahe leer und ich stand zunächst allein bei den Aufzügen. Doch als ich im Lift auf das Schließen der Türen wartete, strömten plötzlich noch etliche andere Gäste herbei. Der letzte Fahrgast bat höflich um Eintritt, zwängte sich auch noch dazu und die maximal erlaubte Personenanzahl war erreicht: Das strenge Wien, meine erste Hotel-Übernachtung seit zwei Jahren und schon kurz nach der Ankunft ein randvoller Aufzug – ich war platt!
Eine Fahrt über fünf Stockwerke bietet zumindest ein paar Augenblicke für Reflexion und ich konnte meine Verblüffung und Freude über die offensichtliche Entspannung meiner Mitreisenden nicht zügeln, denn ich hatte andere Erwartungen an Wiener Gepflogenheiten gehabt. In das irritierte Schweigen hinein, dass dem Schließen der Türen und der Abfahrt eines gesteckt vollen Lifts typischerweise folgt, äußerte ich mit freundlicher Stimme und einem lächelnd faszinierten Ausdruck: „Ist ja fast wie früher!“
Fast – aber eben doch nicht wirklich wie früher: Mein offenes, erleichtertes, womöglich sogar leicht amüsiertes Lachen blieb mir im Halse stecken. Die Irritation über die ungewohnte körperliche Nähe im Aufzug schien sich durch meinen Hinweis auf neue oder alte Normalitäten eher noch verschärft zu haben. Die Atmosphäre wurde spürbar ungemütlich und die Reaktionen der anderen elf Personen waren sehr verhalten und wirkten besonders vorsichtig. Ich war enttäuscht: War die plötzliche und heutzutage ja besonders ungewohnte körperliche Nähe im Aufzug also nicht aus einer bewussten Entscheidung und entspannten Haltung heraus entstanden, sondern im Tun einfach so passiert? Begann bei den übrigen Fahrgästen erst jetzt die Überlegung, ob man sich selber in der Situation wohlfühlt oder entstand durch meine Bemerkung die Befürchtung, andere in ihrem Wohlbefinden zu beeinträchtigen? Verwiesen die eher irritierten Blicke auf die innere Frage, ob eine Maske doch erforderlich oder zumindest sicherer gewesen wäre?
Ich wollte eine spontane Verbindung aufnehmen und hatte eher das Gegenteil erzeugt – das war nun ganz und gar nicht meine Absicht gewesen. Ein anderer Hotelgast sorgte durch eine kurze Lagebesprechung über das geplante Ziel seiner kleinen Reisegruppe für eine schnelle Ablenkung. Ich konnte diesen Wortwechsel aber nicht als Entspannung wahrnehmen, sondern hatte eher den Verdacht, dass dadurch Gruppenstärke demonstriert wurde und dadurch auch eine Legitimation der von mir kommentierten Nicht-Einhaltung von virusbedingtem Abstand. Zum Glück war die Fahrt schnell vorüber.
Seitdem jedoch beschäftigt mich dieser kleine Zwischenfall und ich frage mich, wie es Menschen geht, die womöglich nicht so entspannt reagieren, wenn sie sich plötzlich von elf Fremden im hintersten Winkel eines Aufzugs eingezwängt wiederfinden. Denn was wäre passiert, wenn ich die anderen nicht angelächelt, sondern sie angepöbelt und ihnen Ignoranz unterstellt hätte? Kann jemand, der allein beim Gedanken an solche Situationen eine Panikattacke bekommt, sich überhaupt noch in der Öffentlichkeit bewegen, einen Aufzug betreten, einen Kurzurlaub genießen? Wie geht es Menschen, denen besonders wichtig ist, dass andere sich nicht von ihnen bedrängt fühlen? Ist die so viel gepriesene Solidarität aus dieser Perspektive nicht gar ein Aufruf, dass einem eben nichts – aber auch gar nichts mehr einfach so im Tun passieren sollte? Hatte der unangenehme Stimmungswechsel im Aufzug womöglich mit schlechtem Gewissen zu tun, obwohl ich doch das glatte Gegenteil bezwecken wollte? Mit welchen vielfältigen Befürchtungen, die ich mir gar nicht alle ausdenken kann, laufen wir den ganzen Tag in unserem Alltag herum? Wie viel Energie kostet das jeden einzelnen Menschen und wie sehr wird schon allein damit die Gesundheit gefährdet? Wie unwahrscheinlich werden zufällige, schöne Begegnungen und spontane Herzlichkeit in einer solch belasteten Atmosphäre?
Ich möchte mich in Zukunft wieder unbefangen im öffentlichen Raum bewegen und fremden Menschen begegnen können: Im Aufzug, im Gedränge eines Weihnachtsmarkts oder im Schlussverkauf, beim Sport und im Museum. Können wir also bitte darüber reden? Auch wenn niemand mehr über Corona reden will. Können wir uns dennoch darüber unterhalten, wie wir uns in Zukunft begegnen und wie wir miteinander leben wollen? Oder werden wir uns einer neuen öffentlichen Ordnung und neuen Normalität einfach beugen? Egal, woher sie kommt und von wem sie bestimmt wird?