Spreche ich von Liebe, dann nicht von der verkitschten Version, die nur einen Klick entfernt in Streamingdiensten wie Netflix angeboten wird. Und von der sich, erschreckend genug, immer mehr Paare infizieren lassen – Hochzeitsmessen sind ein wahres Eldorado des Schmonzetten-Klimbims. Was aber verbirgt sich hinter der Rosa-Wolken-Inszenierung? Kommt da noch was?
Einen in die Tiefe führenden Liebesbegriff, der durchaus viel abverlangt, untersuchten die Philosophen und Einander-Liebenden Hannah Arendt und Martin Heidegger. In einem regen Briefwechsel versuchten sie sich an Modifizierungen des Augustinus-Zitats „Amo: Volo ut sis“, wonach der Liebende sich befähigt, zu dem anderen zu sagen: „Ich liebe, das bedeutet, ich will, dass du seist, wer du bist.“ Gemäß Heidegger geht es darum, das Gegenüber „in seinem Sosein und Dassein bejahend zu lassen“. Das führe zu der Überlegung: „Wie bereit ich’s, dass du wohnst im Wesen?“
Fassen wir dieses Ideal der Liebe, wie sie unter zweien sich entfalten kann, grösser. Und denken wir sie außerdem über Familie und freundschaftliche Gruppen hinaus, hin zur Welt. Sind Menschen fähig, sich zu einem Plural zusammenzufinden, dessen Größe und Komplexität den vertrauten Kreis übersteigt, und zwar als solche, die einander liebend bejahen? Anders gefragt: Wie steht es um die Mündigkeit des Herzens?
Die des Verstandes gilt, so heißt es seit dem 18. Jahrhundert, für alle, die mitmachen wollen. Mit der Aufklärung spätestens hat sich der Mensch aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit befreit, also aus seinem Unvermögen, seinen Verstand ohne Lenkung von außen zu nutzen. In Anbetracht der Weltenlage – Hunger, Krieg, Gewalt – ist freilich fraglich, ob ihm das umfassend genug gelungen ist. Adäquat liegt nahe, dass es auch mit der Mündigkeit des Herzens nicht so weit her ist.
Es ist nicht schön, am Menschen zu zweifeln. Man sollte es besser wie Friedrich Nietzsche halten und ihn hin zum Höchsten denken. Natürlich geschieht viel Gutes. Doch: Da geht noch mehr. In der Bergpredigt interpretiert Jesus das Gebot der Nächstenliebe radikal: „Liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen.“ Denn: „Wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes?“
Müssen wir überhaupt so genau wissen, was Liebe sei, oder sollten wir nicht einfach draufloslieben, so gut wir eben können? Die gute Nachricht ist: Genau hier versagt die Künstliche Intelligenz. Zwar brauchte beispielsweise der selbstlernende Algorithmus Alphazero nur vier Stunden, um eine übermenschliche Spielstärke im Schach zu erreichen, aber das war es auch schon. Geht es um die Liebe, schauen KI-Systeme ziemlich alt aus. Mögen sie auch qua Programmierung Empathie und Zuwendung zeigen – es handelt sich, selbst wenn Transhumanisten das anders einordnen, immer um Simulationen. Und simulierte Liebe ist: keine Liebe.
Dass uns die Befähigung zur Liebe von Robotern unterscheidet, ließe sich nachgerade als Aufforderung verstehen. Also: Wie stellen wir es an, es darin zu einer, sagen wir mal, Meisterschaft zu bringen? Vielleicht über Subtraktion: indem wir entfernen, was uns hindert zu lieben.
Rechthaberei beispielsweise. Kann weg. Die Tyrannei der Übereinstimmung. Auch weg damit. Denn erst über die Erkenntnis, dass der andere von mir verschieden ist, lässt sich, da ich immer damit rechnen muss, selbstverständlicher mit der anderen Meinung umgehen. Oder anders: Die Annahme, der andere sei mir ähnlich, also die Idee der Verschmelzung, wozu die meisten neigen, führt bei abweichenden Positionen viel schneller dazu, den anderen als Bedrohung wahrzunehmen.
Die Welt der Bedingungen – „Wenn, dann“ – hört auf, zu existieren, wenn man liebt, auch Feindbilder kommen nicht mehr vor; niemand braucht sich angegriffen zu fühlen, niemand muss sich verteidigen. Und: Es gibt keine Abstufungen. Man liebt nicht diesen einen Besonderen, sondern jeden, der vor einem steht. Bisschen viel verlangt? Mag sein.
Doch genau darum geht es. Liebe ist, so besehen, die wohl noch einzig verbleibende Provokation. Weil wir dazu alles, aber auch wirklich alles aufbringen, uns anstrengen, über uns hinauswachsen müssen. Wer auf andere schießt, sei es mit Worten oder mit Waffen, was leistet der schon? Es ist das Konzept für die Bequemen, die Fantasielosen. Die wider besseres Wissen reflexartig Menschheitsgeschichte wiederholen.
„Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.“ Das soll Albert Einstein gesagt haben, gleichwohl es nicht eindeutig belegt ist.
Nichtsdestotrotz: Es stimmt.
Über den Autor

Sylvie-Sophie Schindler
Sylvie-Sophie Schindler, ist in Oberbayern aufgewachsen. Sie ist in Schauspiel, Philosophie und Pädagogik ausgebildet und hat weit über 1.500 Kinder auf ihrem Entwicklungsweg begleitet. Als Journalistin begann sie bei der Süddeutschen Zeitung, war jahrelang als Lokalreporterin für den Münchner Merkur tätig und belieferte Medien wie stern, VOGUE und GALORE mit ihren Texten. Zig tausend Artikel später orientierte sie sich im Journalismus neu, um frei und ohne Agenda schreiben zu können. Aktuell veröffentlicht sie unter anderem für die WELTWOCHE und Radio München. Sie ist Trägerin des Walter-Kempowski-Literaturpreises. Mit ihrem YouTube-Kanal DAS GRETCHEN will sie die Dialogbereitschaft stärken. In Vorträgen und in Netzwerken setzt sie sich für neue gesellschaftliche Wege ein, die auf Selbstorganisation, Herzoffenheit und freiem Denken gründen.
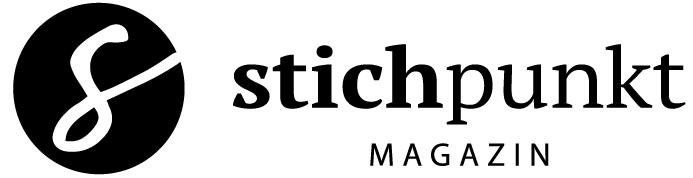

Gretchens Frage: was denn nun Liebe sei – hat mich sehr berührt. Es stellt sich für mich die nächste Frage: Was lässt einen so jungen Menschen ( zumindest lässt dies das Logo erahnen ) so weise werden ? Vielleicht erreicht mich demnächst eine Antwort. Jedenfalls tragen solche Beiträge und die gesamte Redaktion vom Stichpunkt auf eine nicht näher beschreibbare Art zu meinem Daseinsglück bei.